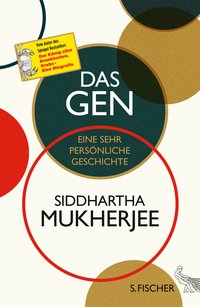Zum Buch:
Siddharta Mukherjee, der 2011 für König aller Krankheiten u.a. den Pulitzer-Preis für das beste Sachbuch bekam, begibt sich mit seinem neuen, über 700 Seiten umfassenden Buch tief in die Geschichte der Genforschung.
Ausgehend von den in seiner eigenen Familie verbreiteten und somit zumindest teilweise erblich bedingten psychischen Erkrankungen (z.B. Schizophrenie), trägt der US-amerikanische Arzt, beginnend bei Platon und Aristoteles, für uns Leser alles zusammen, was zur Entwicklung der heutigen Gentechnik führte, und zeigt, welche unterschiedlichen Vorstellungen über Jahrhunderte hinweg den Diskurs bestimmten.
Noch bis ins 19. Jahrhundert galt die Präformationslehre, also die Vorstellung, es gäbe einen Mini-Menschen im Sperma, einen Homunculus, der nur noch zu wachsen brauchte. Dieser schlüssige (und sehr viel einfachere) Erklärungsansatz enthob die Wissenschaftler der wesentlich komplexeren Aufgabe, einen Codierungs- und Dechiffrierungsmechanismus’ zur Weitergabe von Erbinformationen zu ergründen. „Die Kirche bot diesen Wissenschaftlern einen sicheren Hafen und dämpfte zugleich wirkungsvoll ihre Neugier.“ So erklärt Mukherjee unter anderem die entscheidende Rolle der Religion für das jahrhundertelange Überdauern der Präformationslehre. Fragen nach dem Ursprung des Lebens blieben verboten. Ausführlich und hoch spannend erzählt uns der Autor, wie sich Gregor Mendel und Charles Darwin, trotz ihres religiösen Hintergrundes, ungefähr zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten nicht mehr mit eben diesem Erklärungsmodell zufrieden geben wollten. Wie der eine begann, sich bei seinen Forschungsreisen in Südamerika Fragen über die Ausdifferenzierung der Arten zu stellen, weil er sich an einer Darstellung der Natur ohne Geschichte störte. Und wie sich der andere – später oft als „Vater der Genetik“ bezeichnet – als Mönch und fürsorglicher Gärtner mit seinen Erbsenpflanzen auf die Spur der inneren Vererbung begab.
Gemeinsam mit Mukherjee durchstreifen wir die letzten Jahrhunderte der Genforschung, vorbei an Neandertalern und Cro-Magnon-Menschen, der „mitochondrialen Eva“, die als unser aller Urmutter gilt und die Mukherjee fasziniert, vorbei an der Entdeckung embryonaler Stammzellen und der daraus erwachsenden Sorge um „die Zukunft der Zukunft“, wie sie erstmals bei einer großen Konferenz über Genetik 1972 geäußert wurde. Ab jetzt war es möglich, praktisch jedes Gen zu manipulieren und die Veränderungen dauerhaft im Genom zu verankern. Wenn Mukherjee von der Entstehung einer Maus mit einem Quallen-Gen, das die Maus unter blauem Licht phosphoreszieren lässt, berichtet, fühlen wir uns sofort an Martin Suters leuchtenden Elefanten erinnert. Die entfesselte Welle der Manipulationsmöglichkeiten überschwemmte die Forscher mit komplexen ethischen Fragestellungen: Durften die bereits vorgenommenen Tierversuche auf Primaten ausgeweitet werden? Oder gar auf den Menschen?
Wenn man vom Genom, den Genen und ihrer Erforschung spricht, geht es eben nicht nur um medizinische Machbarkeit und Wissenschaftsgeschichte. Es geht immer auch um die Frage, wie groß die Anteile unseres Menschseins sind, die wir selbst bestimmen können, und wie viel von uns durch Vererbung und Gene vorbestimmt ist. Für diese eher philosophische Frage liefert uns Mukherjee Denkansätze. Durch das minutiöse Nachzeichnen der Geschichte relativiert er die einzelnen Vererbungstheorien und beschränkt sie in ihrer Überzeugungskraft auf ihre jeweilige Zeit.
Als fesselndes, vielfarbiges Mosaik erweckt Mukherjee die nur vermeintlich abstrakte Wissenschaftsgeschichte zum Leben, verknüpft sie mit seinen sehr persönlichen Erfahrungen, und man braucht weder einen medizinischen noch einen wissenschaftlichen Hintergrund, um sich von seiner Begeisterung anstecken und von seiner begnadeten Erzählkunst mitreißen zu lassen.
Larissa Siebicke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt