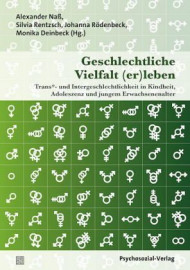
Mit der Thematik Trans*- und Intergeschlechtlichkeit im Kindes- und jungen Erwachsenenalter beschäftigen sich die Autor*innen des vorliegenden Buches aus interdisziplinärer und multidimensionaler Perspektive. Die Beiträge sollen insbesondere pädagogischem und psychologischem Fachpersonal eine Handreichung beim Umgang mit inter- und trans*geschlechtlichen Kindern und Jugendlichen sein und unter anderem dabei helfen, deren spezifische Bedürfnisse, Interessen und Gefühlslagen besser zu verstehen.
Über aktuelle Wandlungsprozesse und Forschungsergebnisse aus diesem Bereich informieren Vertreter*innen aus Psychologie, Soziologie, Biologie und Rechtswissenschaft. Sie alle streben eine differenzierte Informiertheit der Leser*innen an, um den wertschätzenden Umgang mit inter- und trans*geschlechtlichen Personen weiter zu fördern.
Mit Beiträgen von Ulrich Klocke, Emily Laing, Alexander Naß, Eike Richter, Kurt Seikowski, Heinz-Jürgen Voß und Simon Zobel
(Klappentext)