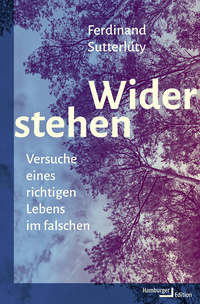Zum Buch:
Es gibt Menschen, die den Mut, die Entschlossenheit und die Beharrlichkeit besitzen, gesellschaftliche Verhältnisse, die sie als falsch erkennen, nicht nur zu kritisieren, sondern sich ihnen ganz konkret zu widersetzen. In seinem „ethnografischen Reisebericht“, wie er sein Buch nennt, portraitiert Ferdinand Sutterlüty acht Personen, die der Versuchung widerstehen, einfach so weiterzumachen und sich mit Ungerechtigkeiten, sozialen Ungleichheiten und ökologischen Zerstörungen zu arrangieren. Ihre Erzählungen führen in unbekannte Alltagswelten, beschreiben Missstände, von denen wir vielleicht abstrakt wissen, die wir aber nicht wirklich kennen; sie hinterfragen weithin geteilte Überzeugungen und Gewohnheiten, werfen ein grelles Licht auf die vermeintliche Normalität unserer kapitalistischen Kultur. Mit ihrem Handeln zeigen sie, dass es Alternativen zu den eingelebten Normen gibt, andere Vorstellungen eines guten Lebens. Ihre Geschichten machen aber auch deutlich, wie verletzlich Menschen sind, die gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen und bestimmte Dinge nicht mitmachen. Auch in offenen demokratischen Gesellschaften gibt es viele Bereiche, die hierarchisch strukturiert sind, Kritik, Widersetzlichkeit und Abweichung negativ sanktionieren. Deshalb verbleibt der Protest oft im Verborgenen, deshalb hat der Autor die Namen der Interviewten anonymisiert und die Geographie ihrer Lebensorte verfremdet.
Wir begegnen in dem Buch einem Seenotretter auf dem Mittelmeer, der in Deutschland Geflüchtete berät und betreut; einer ausländischen Reinigungskraft in Hotels, die gegen Unterbezahlung, entwürdigende Arbeitsverhältnisse, Verachtung und Demütigung kämpft, die ihren Stolz behauptet, sich arbeits- und sozialrechtliches Wissen aneignet und anderen dabei hilft, sich zu wehren; einer Künstlerin, die mit Transmenschen in Europa und Lateinamerika, die im Sexgewerbe tätig sind, arbeitet und die Zeichen setzen und etwas bewegen, aber nicht für den Kunstmarkt produzieren will; einem Berufsschullehrer, der mit großer Heiterkeit gegen eine weitere Herabwürdigung der jungen Menschen an den Regeln des Schulsystems vorbei agiert und auf informellem Weg deren Berufschancen zu heben versucht; einer Forstbeamtin, die diffus spürt, dass die fortgesetzte Privilegierung der männlichen Kollegen nicht in Ordnung ist, aber erst auf dem Weg eines weiteren Studiums im Bereich der Gender Studies zu einer Sprache für die erlittene Diskriminierung findet und nun Klage gegen den Arbeitgeber einreicht; einer Künstlerin und politischen Aktivistin, die auf einem entlegenen Hofgelände wohnt, mit anderen ein Netzwerk kritischer Gesellschaftsanalyse aufbaut, Workshops, Performances und Proteste organisiert; einem Allrounder, der kaum Geld braucht, fast so gut wie keinen Müll produziert und zuweilen mit (Kunst-)Aktionen auf die desaströse Realität der kapitalistischen Verhältnisse aufmerksam macht; einem Bergbauernpaar, das Subsistenzwirtschaft betreibt und gemeinwirtschaftliche Strukturen wiederbelebt und aufrechterhält.
Gemeinsam ist den Protagonist:innen des Buches die Überzeugung, dass sich die gesellschaftlichen Verhältnisse dringend ändern müssen, sie aber nicht auf diese Änderungen warten wollen, sondern im Hier und Jetzt Konsequenzen aus den akuten sozialen Ungerechtigkeiten und ökologischen Verheerungen ziehen. Gemeinsam ist ihnen auch, dass in ihrem Leben zwischenmenschliche Beziehungen einen hohen Stellenwert haben. Und alle würden dem Seenotretter zustimmen, der am Ende des Gesprächs eine fundamentale Anklage gegen die westliche Wohlstandssicherung und das europäische Grenzregime erhebt, die ertrunkenen Menschen im Mittelmeer betrauert und sagt, dass es darum gehe, „anders mit Ressourcen umzugehen und neu zu definieren, was Menschen wirklich brauchen. Wenn ich einfach nur höre: ‚Wir machen unseren Wohlstand‘, werde ich ganz widerständig.“
Sidonia Blättler, Frankfurt am Main