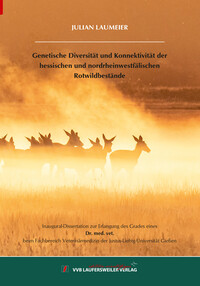
Anthropogene Barrieren, insbesondere Verkehrsinfrastruktur, Jagd und Besiedlung zerschneiden die Habitate der Wildtiere, sodass ein zusammenhängender Genfluss verhindert wird. Die so entstehende Isolation beeinträchtigt die genetische Diversität der Populationen erheblich und dementsprechend den langfristigen Erhalt von Arten. Selbst Populationen mit hohen Tierzahlen leben zwar nebeneinander, können aber nicht als Metapopulationen voneinander profitieren, sodass mindestens ihre Anpassung an den Lebensraum gefährdet ist. Als Kenngröße für Diversität und Anpassungsfähigkeit ist die effektive Populationsgröße in der einschlägigen Literatur etabliert. Die 100/1000-Regel besagt, dass eine Population zum Erhalt der Anpassungsfähigkeit mindestens 1000 genetisch diverse und fortpflanzungstechnisch aktive Tiere benötigt. Sinkt diese Zahl unter 100 so können Inzuchtdepressionen nicht mehr aufgefangen werden und die Tiere dieser genetisch eintönigen Populationen leiden mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Inzuchtdepressionen, welche sich besonders in verminderter Fruchtbarkeit, Krankheitsresistenz und der Insuffiziens anderer polygener Merkmale darstellen. Auch das Auftreten von Missbildungen nimmt mit steigendem Homozygotiegrad zu. Zur Charakterisierung und Bestimmung des genetischen Gesundungszustandes der Populationen in Hessen (HE) und Nordrheinwestfalen (NRW) wurden 2490 Proben in insgesamt 40 Rotwildgebieten genommen. Die Proben wurden mit Hilfe von 16 in Vorläuferstudien ausgesuchten Mikrosatelliten repräsentativ und vergleichbar bearbeitet. Nachdem über Bayes’sche Verfahren, Fst und den Vergleich der Allele die Konnektivitäten der Gebiete untereinander ausgearbeitet wurden, konnten isolierte Gebiete aufgezeigt und von übergeordneten Regionen mit Verbindung abgegrenzt werden. Die Metapopulationen mit vorhandener Konnektivität wurden im Anschluss auf ihren Allelreichtum untersucht und deren Allelpotenzial und effektive Populationsgröße berechnet. In nur zwei Großgebieten, dem Rothaargebirge (acht Probengebiete) und der Eifel (vier Probengebiete) wurde eine effektive Populationsgröße von 1000 im Verbund der Metapopulationen gesichert übertroffen, wodurch die langfristige Anpassungs- und Überlebensfähigkeit gesichert scheint. Sieben der Gebiete lagen unter einer effektiven Populationsgröße von 100, die Bereiche Minden (52,5; NRW), Hünxe (53,4; NRW) und Wahner Heide (99,7; NRW), vier Gebiete unterschritten sogar eine effektive Populationsgröße von 50, der Reichswald Kleve (8,7; NRW), die Nutscheid (17,7; NRW), das Ebbegebirge (19,3; NRW) und der Krofdorfer Forst (44,2; HE), sodass diese nicht mehr in der Lage scheinen auf kurzfristig auftretende Inzuchtdepressionen reagieren zu können. Die Vermutung, dass in NRW durch die höhere Besiedlungsdichte als in HE eine stärkere Verinselung der Rotwildgebiete vorliegt, wurde durch die aktuelle Studie bestätigt. Der direkte Vergleich (Eifel – Waldhessen) zeigte jedoch auch, dass die Vorgaben zum jagdlichen Management des Landes NRW genetisch und damit wildbiologisch besser an das Rotwild angepasst sind als die des Landes Hessen. Beide langfristig anpassungsfähigen Gebiete lagen komplett (Eifel) oder zu großen Teilen (Rothaargebirge) in NRW. Es zeigte sich, dass landesweit pauschalisierende Managementvorgaben den individuellen Gegebenheiten der Rotwildgebiete nicht gerecht werden, sodass, wie in NRW unter Einbeziehung der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung, den Hegegemeinschaften eine besondere Bedeutung in der Erhebung evidenzbasierter Daten der Rotwildpopulationen zukommt. Diese Daten müssen vom Rotwild-Management berücksichtigt werden, um z.B. genetisch notwendige Altersstrukturen und Wanderhirsche zu fördern. Aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden Studie sollte zur Vernetzung der 29 genetisch suboptimal aufgestellten Rotwildpopulationen den Wanderhirschen im Alter von 1-5 Jahren eine besondere Bedeutung zukommen. Die hierzu notwendigen Wanderkorridore müssen erschlossen, freigehalten und gegebenenfalls neu geschaffen werden, um die voneinander getrennten Rotwildgebiete wiederzuvernetzen. Hirsche im Alter bis fünf Jahre sind demnach in rotwildfreien Gebieten zu schonen und bauliche Barrieren, wie z. B. Autobahnen, müssen passierbar sein. Ganzheitlich gedachte Konzepte des facettenreichen Rotwildmanagements mit Zonierungen für Mensch und Tier, Einbeziehung der Bevölkerung, einer Politik auf Augenhöhe und der Beachtung der klimatischen, ökologischen und ökonomischen Bedingungen sind zwar eine immense Herausforderung aber unabdingbar, um unseren Wildtieren und besonders dem Rotwild eine Zukunft zu erhalten. Die lückenlose Beweiskette dieser Studie zur Ausarbeitung isolierter Populationen (STRUCTURE, DAPC, BAPS, TESS, Fst und Allelvergleich), genetischer Verarmung (Allelpotenzial und effektive Populationsgröße) bis hin zu signifikant erhöhten Homozygotiewerten bei misgebildeten Individuen aus Vorgängerstudien beweisen die Probleme des Rotwildes trotz lokal oft hoher Vorkommen und zeigen ein bislang suboptimales Management. Die aufkommenden Konflikte sind dabei hauptsächlich ökonomisch-menschlicher Natur, schaden aber dem Rotwild kurzfristig durch jagdliche Mortalität und mittel- bis langfristig durch genetische Letalität.